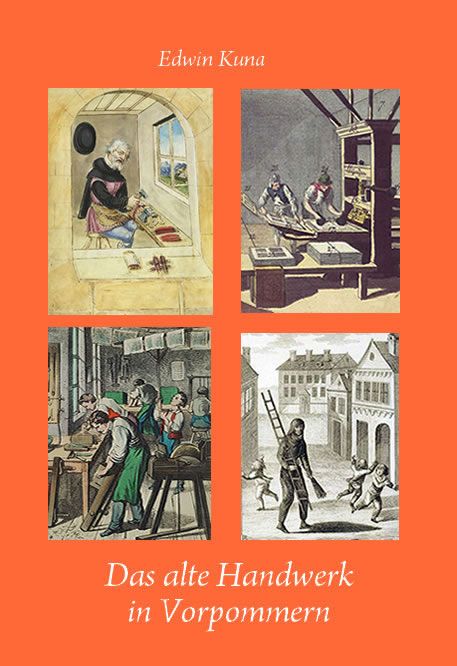Einführung in die Handwerksgeschichte
Handwerk besitzt goldenen Boden, diese Handwerksweisheit ist uralt, sie findet auch heute noch ihre Zustimmung, doch im weiteren Nachdenken über „den goldenen Boden“ folgt in der Regel nicht nur Zustimmung - auch das hat Tradition. 1652 schrieb der Rostocker Universalgelehrte Johann Wilhelm Lauremberg (1590-1658) auf der Suche nach seiner wahren Bestimmung: „Wat is it vör ein stand, de mi kond wol stahn an? Schold it nicht raetsam sin, ik würd ein handwerksman? Twar jedes handwerk wol ein’n boddem heft van golde, dennoch ein handwerksman nicht gern ik werden wolde: …“.
Handwerksgeschichte ist eine komplexe Angelegenheit, sie ist eng verbunden mit der Landesgeschichte, der Stadtgeschichte, mit der Geschichte von Technik, der Kunst und der des Rechts, mit religiösen und moralischen Anschauungen, regionalen Traditionen und Bräuchen. Die vorliegende Darstellung bezieht sich auf einen langen Zeitraum vom 13. bis Anfang des 20. Jahrhundert, die Aussagekraft der Darstellungen ist folglich abhängig von der jeweiligen Materialsammlung.
Durch die ursprüngliche Arbeitsteilung und Spezialisierung im Handwerk hatte beispielsweise Rostock über die Zeit von über 600 Jahren etwa 150 einzelne Professionen. Im Jahr 1760 wies Rostock 60 Handwerksämter aus, im Vergleich dazu gab es in Lübeck 65 und in Hamburg 58 Ämter bzw. Zünfte. Nicht wenige dieser alten Gewerke verweisen auf den besonderen Status der Stadt Rostock. Als Rostock z. B. zeitweise fürstliche Residenzstadt war; da brauchte keiner so viele Kleider, Perücken, Puder, Schmuck und andere feine Waren wie der fürstliche Hofstaat, wenn das Herzogshaus Empfänge, Ritterturniere und Essen- und Trinkgelage veranstaltete. Ausschließlich die privilegierten Hofhandwerker durften diesen Bedarf aufgrund ihres hochwertigen Könnens bedienen. Dann ab 1494 wurde Rostock Universitätsstadt (mit Unterbrechung von 30 Jahren) und auf der Alma Mater benötigten die gelehrten Professoren und Studenten spezielles Papier, Schreibzeug in vielerlei Machart und selbstverständlich Bücher. In dieser Zeit siedelten sich u. a. bevorzugt die Handwerker der schwarzen Kunst hier an: Buchbinder, Buchdrucker, Buchhändler und später Lithografen.
Und als ganz wichtig für Rostocks Handwerkerschaft erwies sich die geografische Lage des Gemeinwesens als einer Handelsstadt dicht am Meer gelegen. Rostock war von altersher eine anerkannte Seestadt; die Seefahrt auf offenem Meer, förderte den Boots- und Schiffbau mit deren Nebengewerben wie die Ankerschmiede, Reifer, Segelmacher oder Teerbrenner. Bereits im Mittelalter ging es zum Fischfang „vp de Schonesche reyse“ raus zur schwedischen Insel Schonen. Der reiche Heringsfang musste in Salzfässern für die lange Reise haltbar gemacht werden und darüber hinaus auf Monate zum Verbrauch vorrätig sein. Tausende Tonnen bzw. Fässer wurden für den Fisch immer wieder aufs Neue vom Böttcherhandwerk angefertigt.
Mit der Seefahrt entwickelte sich Rostock zur Handelsstadt und das brachte fremdländisches Leben in die Stadt. Mit dem Handel beschäftigten sich die „kleinen Krämer“, Weinhändler, Fruchthändler, Fischseller, Glashändler, Kohlenmesser, Heringswracker, Hopfenwracker, Kornmakler, Kornmesser, Zitronenhändler, Drogeköper, Waren- und Wechselmakler, die ebenfalls nicht vom Handwerk zu trennen sind.
Lehrling ist jedermann - Geselle, wer was kann - Meister, wer was ersann
Ein Bummel durch die engen Straßen und Gassen der historischen Siedlungskerne unserer alten Hansestädte gibt uns mancherlei Einblicke in die Vergangenheit. Schon die Beschriftung der Straßenschilder erzählt von den Menschen, die vor Jahrhunderten hier lebten und ihre Gewerbe betrieben. Die unvollständige Aufzählung vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt der handwerklichen Tätigkeiten: Brauereigasse und Fischbank, Reeper- oder Reiferbahn, Hüerbaasweg und Glatter Aal, Hopfenmarkt, Wollenweberstraße und Mühlenberg, Burgwall, Kütertor und Kramerbrücke, Fleischerwiese, Gerberhof und Böttcheramt und etliche andere mehr. Die Namensgebungen beweisen, dass Handwerker und ihr Handwerk neben den Kaufleuten und Schiffern beim Aufstieg der Städte des Wendischen Quartiers der Hanse, auf dem Weg zu Wohlstand und Reichtum maßgeblich beteiligt waren.
Die Geburtsstunde des Handwerks lag weit vor der Zeit, da deutsche bzw. dänische Eroberer in Mecklenburg und Vorpommern einfielen und Siedlungsräume für Zuwanderer schufen. Als die Menschen die Gewinnung und Verarbeitung des Eisens entdeckten, als man das Spinnen und Weben erfand und das Töpfern erlernte und sich für diese Arbeiten Fachleute herausbildeten, wurde das Handwerk geboren. Das liegt Jahrtausende zurück. Plötzlich waren Fachkenntnisse und Fähigkeiten erforderlich, die bei der Mehrheit der Familien- oder Sippenmitgliedern nicht nachzuweisen waren. Die Lage solcher Wohnplätze an den Handelswegen erhöhte den Bedarf an handwerklichen Erzeugnissen, führte schließlich zur Entstehung von Großsiedlungen, von Städten. Nur auf Europa bezogen, drang das Handwerk, drangen die Handwerker und die von ihnen hergestellten Waren im frühen Mittelalter von den Städten Italiens in den süddeutschen Raum vor. Dort kam es zur Unterteilung der einzelnen Gewerke, zur Herausbildung von Handwerksregelungen und -bräuchen und Vereinigungen. Als die deutsche Zuwanderung in Richtung der ehemals slawischen Regionen östlich der Elbe begann, brachten die Handwerker unter den Neusiedlern ihre ausgeprägten Arbeitstechniken und Lebensweisen mit. Bei dem stürmischen Wachstum der gegründeten Städte und dem enormen Warenbedarf bot sich kaum Gelegenheit für die Erprobung von Alternativen gegenüber dem Althergebrachten. Geringe Einflüsse übten die natürlichen Bedingungen in der neuen Heimat und bewahrte Traditionen der vorher hier tätigen slawischen Handwerker aus. Was sich im süd- und westdeutschen Raum jedoch allmählich über lange Zeit hinweg entwickeln konnte, drang mit der Ostexpansion als erprobtes und gefestigtes System in das dünn besiedelte Slawenland vor. Wie rasant sich das vollzog, beweist zum Beispiel der Umstand, dass sich um 1220 die ersten Deutschen unter die Bevölkerung der alten Slawensiedlung „Roztoc“ mischten, innerhalb weniger Jahre zusätzlich drei weitere deutsche Stadtteile in nächster Nähe entstanden, die sich ebenso schnell 1265 zum mittelalterlichen Rostock zusammenschlossen. Bauern und Handwerker, Kaufleute und Adlige, aber auch Mönche setzten sich überall im Land fest, errichteten Dörfer und Städte, bauten Burgen und Klöster.
Nach den Siedlungsgründungen schlossen sich die Städte im Hansebund zusammen. Den Reichtum produzierte vor allem die Mittelschicht, die Oberschicht verwandelte ihn in politische Macht. Zu den Patriziern gehörten die Geistlichkeit, die wohlhabenden Fernkaufleute und die Ratsherren. Beim Patriziat achtete man auf bedingungslosen inneren Zusammenhalt, isolierte sich gegenüber den anderen sozialen Gruppen, rekrutierte die jeweiligen Nachfolger für die verschiedenen Ämter über Generationen hinweg aus den gleichen Familien. Die Mittelschicht machte zwar den überwiegenden Anteil der Stadtbevölkerung aus, verfügte aber zur Gründungszeit und in den nächsten Jahrhunderten kaum über politische Rechte. Hierzu zählten vor allem die Handwerker, aber auch die Schiffer und die Kramer. Die Spannungen zwischen diesen beiden Schichten entluden sich immer wieder bei Auseinandersetzungen, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert währten und in deren Verlauf die Handwerker ihren Einfluss auf das Stadtregime ausdehnen konnten. Die dritte Gruppe dagegen war völlig rechtlos, konnte allerdings auch wenig zur Änderung dieser Situation ausrichten. Zu den Plebejern rechnete man auch die Handwerksgesellen, die erst im vorigen Jahrhundert eine gewisse Anerkennung als Stadtbürger erfuhren, dazu die Tagelöhner, die Bootsleute, die Stauer, die Träger, die Fuhrleute und das Gesinde.
Die Entwicklung von Handwerk und Gewerbe in den Städten des historischen Mecklenburg-Vorpommerns verlief nahezu parallel, auch wenn kaum Kontakte zwischen den Orten bestanden. Man unterstand verschiedenen Fürsten, man war eingegrenzt, man führte bis 1350 sogar Kriege gegeneinander, man rechnete mit unterschiedlichen Gewichten, Maßen und Münzen, man entwickelte sich gewissermaßen nebeneinander her.
Die Dörfer im alten Mecklenburg und Vorpommern konnten beim Aufschwung des Handwerks nicht mithalten, denn die Chancen waren ihnen verwehrt. Die Vereinigungen der Handwerker in den Städten, die Zünfte oder, wie sie in unserer Heimat genannt wurden, die Ämter, achteten streng darauf, dass sich in den Dörfern der jeweiligen Umgebung kein Konkurrent niederließ. Der Rostocker Rat erließ frühzeitig eine Bannmeile im Umfang von 2 Meilen um die Stadt, die hier den Zugang auswärtiger Produkte, außer zu den genehmigten Märkten, verbot. Gleichhin durften die Ortschaften innerhalb des Meilenbereichs nur Rostocker Waren beziehen, was sich nicht nur auf das Bier bezog.
Das Handwerk auf dem Lande wurde generell von den jeweiligen Landesregierungen Mecklenburgs bis in das 19. Jahrhundert hinein, und einseitig zum Wohl und im Interesse der Städte, stark eingeschränkt. Die meisten Gewerke wurden durch landesherrliche Verordnungen auf den Dörfern strikt verboten. Ausnahmen machten das Schmiede- oder Stellmacherhandwerk, die Rademacher, die Mühlen, späterhin Ziegeleien und Kalkbrennereien. Zur Ausnahmeregelung gehörte dann auch, dass diese Land-Meister keine Lehrlinge aufnehmen und ausbilden durften, bei Bedarf war der Nachwuchs zur Ausbildung zum Stadtmeister zu schicken. Auch der Umfang der Gesellenhaltung bei den Dorfmeistern wurde reguliert.
Was der Bauer und Landmann an Handwerkswaren benötigte, musste er in der Stadt kaufen. Die zünftige Ordnung bestimmte, was sich „ziemte". Sie untersagte, was ihren Regeln widersprach.
Etwas günstiger für das Landhandwerk sah es bis zur Reformation in jenen Dörfern aus, die zum Besitz eines Klosters zählten, und das waren nicht wenige. Die Doberaner Zisterzienser beispielsweise besaßen etwa 40 Dörfer zwischen der Kühlung und den Rostocker Stadtgrenzen, sogar in der Altmark und in Pommern. Durch Kauf, Schenkung oder recht unchristliche Fälschung hatte man Glashütten, Fischteiche, Brennereien, Salzpfannen und Mühlen in seinen Besitz gebracht und genoss Zollfreiheiten auf fremden Märkten. Beim Klostereigentum endete der Einflussbereich der so mächtigen Städte und teilweise auch Macht der Landesherrschaft. In Ostelbien leisteten die Klöster Pionierarbeit. Bisher im Lande unbekannte Methoden der Viehzucht, des Feld- und Gartenbaus verbreiteten sich von hier aus, denn die Ordensbrüder waren nicht alle Mönche, die ihre Jahre mit Bet-Übungen und sakralen Zeremonien verbrachten. Mehrheitlich waren sie Arbeitsmönche und verstanden sehr wohl ihr Handwerk. Aber auch hier spielte das slawische Erbe mit, denn gerade die Arbeitsmönche waren oft slawischer Herkunft. Die klösterlichen Bauten, soweit sie erhalten sind, und das Innere der mittelalterlichen Kirchen, Dome und Münster zeugen von der Qualität und Kunstfertigkeit der damaligen Handwerker. In den Klosterhöfen gab es kein ausgeprägtes Zunftwesen, an dessen Stelle jedoch ebenso organisierte Bauhöfe und Gewerke.
Das mecklenburgische Handwerk in seinem vollem Umfang konnte sich nur in den Städten entwickeln. Mitglied einer städtischen Zunft konnte nur werden, wer das Bürgerrecht erwarb, christlichen Glauben war und einen entsprechenden Meisterbrief vorwies. Verschnörkelt und gerahmt zieren die Urkunden heute noch die Laden oder Werkstätten traditionsbewusster Handwerksmeister. Manchmal sogar in Reihe aufgehängt, weisen sie nach, dass bereits Urahn, Großvater und Vater das gleiche Gewerbe ausgeübt hatten. Das war schon im Mittelalter üblich.
Doch für einen Nachkömmling in einer Handwerkerfamilie war es schwierig, den harten Weg zum Jungmeister zu bewältigen. Auswärtige Kinder dagegen besaßen schon weniger Chancen. Zunächst musste in Rostock der künftige Lehrbursche vor dem Amt seine „ehrliche Herkunft" nachweisen, also seine eheliche Geburt in einer deutschen und christlichen Familie bezeugen können. Damit waren im Mittelalter Slawen- und Judenkinder vom Handwerksberuf ausgeschlossen. Der vom Amt für ein Lehrgeld vom Vater aufgenommene Bursche musste neben der Ausbildung so gut wie alles erledigen, was in der Werkstatt, auf dem Markt, in der Familie des Meisters und im Haushalt an Arbeiten anfiel. Ein 13-stündiger Arbeitstag ohne freien Sonntag war nichts Außergewöhnliches für einen „Stift“. Dafür lebte er aber auch wie die Gesellen mit im Meisterhaus.
Der allererste Lehrtag begann mit dem Borgegang zu einem anderen Meister des gleichen Gewerbes, wozu man nach Möglichkeit recht weite Wege bevorzugte. Der Lehrling hatte beispielsweise ein dem jeweiligen Handwerk entsprechendes Fantasiewerkzeug zu holen, etwa den Böschungshobel, den Knochenamboss, die Ledermühle oder die Ballastwaage. Der so angesprochene Meister kannte selbstverständlich den Ulk, erklärte sich mit würdevoller Miene zur Aushilfe bereit und entzog sich dem Zublick des Jungen. Dann packte er irgendwelchen wertlosen, aber schweren Kram in einen Sack, stopfte ein paar Steine hinzu und übergab alles dem Jungen, der das Gewicht kaum zu heben vermochte. Mit der strikten Anweisung, den wertvollen Inhalt recht vorsichtig zu transportieren, machte sich der Bursche auf den Rückweg zu seinem Meister, wo er mit Spott und Gelächter empfangen wurde. Diese Sitte hat sich bis heute erhalten, nicht nur bei den kleinen Handwerksmeistern, sondern auch in den Großbetrieben der Bau- und Schiffbaubranche.
Mit dem Ende der überwiegend drei- oder vierjährigen Lehrzeit begannen die vielseitigen Vorbereitungen auf die „Freisprache vor offener Lade und Büchse“ und die Arbeit an dem vom Meister in Auftrag gegebenen und vom Amt bestätigten Gesellenstück. Beim Gesellenstück durfte keinerlei Hilfe oder auch nur Rat in Anspruch genommen werden, obwohl die Meister, um ihren Ruf als Lehrherren zu wahren, diese Bestimmung nicht immer einhielten. Für die Freisprache, hauptsächlich jedoch für die damit verbundenen Nebenaufgaben, suchte sich der Kandidat zwei „Beitreter“, zwei Schenkgesellen. Letzteres deutet bereits an, dass schon bei der Gesellenprüfung allerhand Essbares und Trinkbares geboten werden musste, was sogar betreffs Menge und Sorte in der Amtsrolle festgelegt worden war, abgesehen von den dort ebenfalls genannten, zu entrichtenden Barbeträgen. Vor allem aber musste man sich durch entsprechende Bewirtung das Wohlwollen der Amtsmeister sichern. So vorbereitet, trat der Prüfling vor den Altermännern und beantwortete die traditionellen Fragen: „Mit Gunst und Erlaubnis, was ist sein Begehr?“ – „Mit Gunst und Erlaubnis, mein Begehr ist, dass ich mich vor drei Jahren in die Lehre beim hochlöblichen Meister der Zunft ...“. In würdiger, vorgeschriebener Weise wechselten Fragen und Antworten, bis der Altermann den erlösenden Satz sprach: „Kraft meines Amtes spreche ich ihn frei nach Handwerksbrauch und –gewohnheit“. Die vom Junggesellen ausgerichtete Bewirtung schloss sich an und beanspruchte weit mehr Zeit. Damit waren die Prozeduren allerdings noch nicht überstanden. Auf ähnliche Weise, wenn auch weniger kostenaufwendig, verlief die Aufnahme des Junggesellen in die Gesellenbruderschaft in der Herberge, dem Sammelpunkt und Anlaufpunkt der Gesellen in der Stadt. In großen Städten verfügte jedes Handwerk über eine eigene Herberge, ansonsten hielten sich die Gesellen mehrerer, meist verwandter Handwerke gemeinsam einen solchen Bau. Die Aufnahme in die Bruderschaft war für den Junggesellen dennoch wichtig, denn hier traf er auf seine Standeskollegen, die ihn im Laufe der Zeit mit all dem Wissen und den Kniffen vertraut machten, die jener für die folgende Etappe seines Berufsdaseins benötigte.
Das war die Wanderschaft. Die meisten Amtsrollen schrieben dafür eine Wanderzeit von drei Jahren und einem Tag vor. Die Tippelbrüder waren einverstanden, genossen sie doch nach den schweren Lehrjahren endlich die ersehnte Freiheit und lernten ein Stückchen Welt außerhalb von Rostock kennen. Es gibt Berichte, wonach Gesellen ihre Wanderschaft bis zu zwölf Jahren ausdehnten und erst dann schweren Herzens in die Enge eines städtischen Handwerkerdaseins zurückfanden. Mit Felleisen und Wanderstock, in ihrer Zunfttracht und dem traditionellen Ring im Ohrläppchen zogen sie durch die Lande.
Das pflichtgemäß mitgeführte Wanderbuch diente nicht nur zur Eintragung der jeweiligen Arbeitsstellen, es war gleichzeitig der Pass. Gesellen, die während des 19. Jahrhunderts im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin ohne Wanderbuch unterwegs waren, wurden bestraft. Die hier ebenfalls vorgeschriebene Auslandswanderschaft war kein Problem. Man brauchte nur von Ribnitz über die Recknitzbrücke nach Damgarten zu gehen, und schon war man im Ausland.
In einer neuen Stadt angekommen, zupfte der Tippelbruder sein Zeug zurecht, präsentierte die an der Uhrkette baumelnden Stadtwappen seiner bisherigen Arbeitsstellen, kreuzte den Wanderstock vor der Brust und strebte, oft gemeinsam mit anderen unterwegs aufgesammelten Gesellen, der Herberge zu, erkennbar an dem über der Tür angebrachten Zunftzeichen. Auch diese Symbole haben überlebt und zieren heute noch den Eingang zu manchem handwerklichen Betrieb: Barbierbecken, der Hobel, das Hufeisen oder der Bäckerkringel. Die Herberge bot dem Gesellen nicht nur Quartier und Beköstigung, sie war vor allem der Ort, den der Wanderbursche anzulaufen hatte, wenn er vermittelt werden wollte. Hier hinterließen die Meister ihre Stellenangebote, die sie nach Bedarf und im Rahmen der Festlegungen ihres Amtes stellen durften. Der eigentliche Vermittler war der Altgeselle der jeweiligen Bruderschaft. Auch wenn in der Stadt keine Stelle frei war, durfte der wandernde Geselle in der Herberge bleiben und erhielt auch seine Eintragung ins Wanderbuch. Die selbstständige Suche nach einem Arbeitsplatz war untersagt. Auch andere Verstöße gegen die Regeln der Bruderschaft wurden geahndet und abgestraft. Der Bursche verlor z. B. seinen Ohrring und galt fortan als „Schlitzohr“.
Ansonsten ging es in den Herbergen recht fröhlich zu. Die Burschen hatten viel erlebt und hatten viel zu erzählen, wenn der Gerstensaft erst einmal die Zungen löste. Die bereits im 14. Jahrhundert entstandenen Bruderschaften der Gesellen verfügten nicht nur über eigene Herbergen, sondern auch über eigene durch Spenden, Gebühren und Strafgelder gefüllte Kassen. In Not geratenen Gesellen konnte geholfen werden. Man hatte seine eigene auf Pergament und später auf Papier geschriebene Rolle, sein Statut, das in einer Holzkapsel verwahrt wurde. Man hatte seine eigene Lade, die Truhe, in der alles lagerte, was für die Bruderschaft von Wert war. Man hatte seinen eigenen „Willkomm“ (Krug, Pokal), der bei Freisprachen oder bei anderen festlichen Anlässen reihum gereicht wurde. Die meisten bereits ansässigen Gesellen hatten in der Herberge auch ihren eigenen Becher stehen und nutzten ihn nach „Feier“-Abend. Dabei ging es allerdings nicht immer friedlich zu. Oft gerieten die Gesellen verschiedener Gewerbe aneinander. Auch von tätlichen Auseinandersetzungen mit Studenten in Rostock wird berichtet, die sich dann trotz entsprechender Verbote und empfindlicher Strafandrohungen auf den nächtlichen Straßen abspielten. Man hatte seinen Berufsstolz und fühlte sich allen anderen überlegen. Davon zeugen allein schon die fast beleidigenden Spottnamen für die jeweils anderen: „Deigapp“ für den Bäcker, „Kaminratt“ für den Schornsteinfeger, „Pickhingst“ für den Schuhmacher, „Zagenbuk“ für den Schneider, „Rutenquäler“ für den Korbmacher oder „Mehlworm“ für den Maurergesellen.
Wer die Jahre der Wanderschaft hinter sich gebracht hatte, weder wegen nächtlicher Ruhestörung noch wegen verbotenen Beischlafs bestraft worden war und insgesamt eine „saubere Weste“ nachweisen konnte, der durfte theoretisch den begehrten Meistertitel anstreben. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die Hürden lagen einerseits bei der Begrenzung der Anzahl der Meister des Gewerbes und andererseits an dem gewaltigen finanziellen Aufwand, den der Bewerber zu leisten hatte. Die Amtsrollen legten nicht nur die in der Stadt zulässigen Meister fest, sondern auch die Zahl der Gesellen und Lehrlinge. Handwerksamt und Rat konnten bei voller Handwerkerzahl dann gemeinsam beschließen, dass das Amt geschlossen wurde. Andererseits konnte der Rat bei zusätzlichem Arbeitsbedarf, auch gegen den Willen des Amts, eine sogenannte Freimeisterstelle schaffen. Da aber überwiegend die alteingesessenen Handwerkerfamilien ihre eigenen Söhne als Nachfolger bevorzugten, hatten es die fremden Zuwanderer meist schwer, so gut sie ihr Handwerk auch verstanden. Nur wirklich alleinstehenden Meisterwitwen war es gestattet, einen „Werksgesellen“ einzustellen und mit dessen Hilfe das Geschäft, wenigstens für eine vorgegebene Zeit, weiterzuführen. Solche Frauen wandten sich dann oft direkt an die Bruderschaft um einen Gesellen, der später als Werksgeselle bei seinem Antrag auf Meisterprüfung nicht nur bei den Zunftmeistern offene Ohren, sondern auch bei der Meisterwitwe finanzielle Unterstützung fand. Auch durch Einheirat konnte man zum Meisterbrief vorstoßen. Es war durchaus nicht ehrenrüchig, auf derartige Angebote einzugehen und damit, wenn auch mit einer nicht mehr ganz frischen Ehefrau, in den festgefügten Clan der Handwerksmeister vorzudringen. Wer gar ein Meistertöchterlein einzufangen wusste, der hatte nicht nur für die Zukunft beste Aufstiegschancen, sondern auch die schnucklige Beigabe. Die Amtsrollen regelten also auch unter dem Vorwand gewerblicher Kompetenzen viele Bereiche des Zusammenlebens der handwerklich tätigen Stadtbürger.
Dennoch gab es in dieser Zeit immer wieder Gesellen oder auch Meister, die Bestimmungen zu umgehen versuchten und den Ämtern „ins Handwerk pfuschten“. So wurden verschiedentlich Schwarzarbeiter, Schwarzarbeiterinnen oder auch ungelernte Hilfskräfte im Haus versteckt und mit gering bezahlten Zuarbeiten beschäftigt, was laut den Amtsstatuten verboten war. Die „Boenhasen“ oder Bodenhasen, weil sie auf dem Hausboden untergebracht waren und dort auch Werkeln mussten, und bei eventuellen Kontrollen nicht entdeckt zu werden. Doch das war bei der Enge in der alten Stadt, bei der unmittelbaren Nachbarschaft mit den anderen Meistern des gleichen Gewerbes und bei den fast familiären Bindungen aller Zunftmitglieder ein gefährliches Unternehmen. Die Ertappten hatten mit schweren Strafen, mit öffentlicher Bloßstellung, mit Aberkennung der Amtszugehörigkeit, sogar mit Verlust der Bürgerrechte oder mit Ausweisung zu rechnen.
Wie die Freisprache zum Gesellen, so wurde auch die Erhebung in den Meisterstand vor offener Lade, allerdings mit noch größerem Aufwand begangen. Ansonsten ähnelten sich beide Zeremonien. Die Zunft beriet das zu fertigende Meisterstück, überprüfte die Herkunft und den bisherigen Ausbildungsweg des Bewerbers, zog die schon zuvor mit den drei Eschungen (Anträgen) zu entrichtenden Gebühren ein und prüfte genau den Mann, der es unternahm, in ihre ehrenwerte Sozietät einzusteigen. In alten Amtsrollen ist nachzulesen, wie hoch die Gebühren waren, aber auch, was anlässlich einer solchen damit verbundenen Festlichkeit an „Meisterkost" verfügbar sein musste, wie viel Brot, Fleisch und Bier die Amtsmitglieder zu verzehren gedachten.
Eine Meisterwerdung war ein gesellschaftliches Ereignis für alle Amtsfamilien, die sich allerdings erst versammelten, wenn der eigentliche Höhepunkt vorüber war, wenn die „geschworenen“ Altermänner und Mitmeister das neue Mitglied als Jungmeister aufgenommen hatten. Regelmäßig angesetzte „Morgensprachen“ förderten zusätzlich das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Amtsmitglieder. Daran teilzunehmen, war Pflicht aller Meister der jeweiligen Zunft. Zunächst befasste man sich mit allen Problemen, die im Laufe des vergangenen Vierteljahres im Alltag der Zunft vorgefallen waren. Einzelne Meister wurden belobigt, andere wurden kritisiert. Während man anfangs unter sich blieb, stellten sich im Verlauf der bis in die Nacht währenden Morgensprachen auch die erwachsenen Familienmitglieder der Meister ein, und es wurde tüchtig gefeiert. Mancher „Quartalssäufer" kam hier endlich wieder mal auf seine Kosten, denn die Morgensprachen nannte man auch „Quartale".
Die Amtsrollen und Statuten umfassten in erster Hinsicht alle Vorschriften für die Warenproduktion, den Rohstoffeinsatz und den Fertigungsprozess, die Verkaufsvorschriften und die Preise. Insbesondere das Lebensmittelgewerbe durfte seine Produkte nur auf ausgewiesenen Plätzen innerhalb des Stadtzentrums, in vom Rat verpachteten Scharren oder Buden, auf Bänken oder in Ständen, verkaufen, was die Kontrolle durch die Altermänner und durch vom Rat beauftragte Personen ermöglichte. Die wichtigste Instanz bei allen Handwerkerwaren war der Kunde, der Käufer. Er beurteilte, wer das beste Produkt anbot und bestimmte letztendlich, wer den größten Absatz machte. An den Markttagen waren auch die Bauern der Umgebung zugelassen, die sich beim Verkauf ihrer Lebensmittel den gleichen Regeln und Kontrollen aussetzten.
Trotz pingeliger Regelungen gab es besonders im Vorfeld von Wochen- und großen Jahrmärkten immer wieder Streitigkeiten zwischen dem Rat und den Ämtern. Die Stadtobrigkeit wollte wegen der zu erwartenden Einnahmen möglichst viele Anbieter aus Nah und Fern herbeilocken und ließ sich dazu
Das 19. Jahrhundert sollte das Ende der zünftigen Handwerkszeit bringen. Mit dem Jahr 1810 lockte von dem Nachbarland Preußen die Gewerbefreiheit, vom pommerschen Damgarten nach dem mecklenburgischen Rostock, herüber. Die herzogliche Regierung von Mecklenburg-Schwerin sowie die Stadt Rostock reagierten zunächst äußerst verhalten. Selbst die Handwerksämter Rostocks reagierten auf die Gewerbefreiheit eher zurückhaltend, sogar skeptisch und forderten vom Herzogregenten die Festschreibung ihrer alten Traditionen und Rechte.
Und dennoch führte im Laufe der Zeit der Einfluss bürgerlicher Aufklärung und der Einzug neuer Technik zu bemerkbaren Wandlungen im Handwerk. Bald arbeiteten die Mühlen nicht mehr ausschließlich mit Hilfe von Wasser und Wind, sondern mit der Dampfkraft und am Ende des Jahrhunderts mit Elektrizität. Alte Handwerkstechniken und Arbeitsmethoden wurden ersetzt durch neue effektivere industrielle Produktionsweisen. Mit der Erschließung neuerer Verkehrswege (Chausseen und Eisenbahn) erweiterten und verbesserten sich die Absatzmöglichkeiten für die Produkte. All das führte letztlich dazu, dass sich einige Gewerke in neuen Vereinigungen organisierten. Man strebte in Mecklenburg danach Handwerk, Kunst und Wissenschaft miteinander zu vereinen und gründete in dieser Art zu Mitte des 19. Jahrhunderts neben noch bestehenden Zünften und Ämtern Gewerbevereine. So entstand auch 1843 der Rostocker Gewerbeverein, der schon zu Anfang über 500 Mitglieder zählte und nun zum Pfingstmarkt die Gewerbeausstellung organisierte. Jetzt nahm der Gewerbeverein in Zusammenarbeit mit Rat besonderen Einfluss auf die theoretische Ausbildung der Lehrlinge durch Einrichtung einer Sonntagsschule (später Fortbildungsschule).
Überdies organisierten sich einige Ämter, teilweise nannten sie sich schon Innungen, wie die der Bäcker, Baumeister, Buchdrucker, Fleischer, Gastwirte, Müller, Uhrmacher oder Friseure in Zentralen- bzw. Dachverbänden. Zu ihren landesweiten Verbandstagen schickten die Innungsvorstände dann Delegierte, die beauftragt waren, eigene Gewerksinteressen dort zu vertreten bzw. beschlossene Verbandsregeln in Empfang zu nehmen.
Das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin trat 1867 dem Norddeutschen Bund bei. Seit dem 1. Januar 1868 Jahr galt das Gesetz über die Freizügigkeit, nach der ein fast uneingeschränkter Aufenthalt und Zuzug für alle Bundesangehörigen gewährt wurde. Ein Jahr später erfolgte die Einführung der Gewerbefreiheit. König Wilhelm von Preußen ordnete im Namen des Norddeutschen Bundes an, dass von nun ab, das den Zünften und kaufmännischen Korporationen zustehende Recht, andere vom Betriebe eines Gewerbes aufzuschließen, aufgehoben sei. So konnte nun in der Stadt sowie auch auf dem platten Lande jeder Handwerksbetrieb errichtet werden. Weiter durfte jeder Gewerbetreibende Lehrlinge, Gesellen und Arbeiter nach eigenem Ermessen halten. Lediglich eine gewerbliche Genehmigung (Gewerbeschein) zur Betriebsführung galt als gesetzliche Voraussetzung.
Mit der Freizügigkeit und Gewerbefreiheit waren für das Handwerk neue Rahmenbedingungen geschaffen. Das Handwerk stand nun erstmals unter den marktwirtschaftlichen Bedingungen der freien Konkurrenz.
Autor: Hannelore Kuna